Netzwerk Fotoarchive: Anlaufstelle für Fotografen und Foto-Sammlungen
Einst galt das Archiv dem Fotografen als sichere Bank für die Altersversorgung. Heute treibt nicht wenige Kolleginnen und Kollegen die Frage um, was passiert mit meinen Aufnahmen, wenn ich mich räumlich einschränken muss oder nicht mehr da bin. Alles nur noch Müll?
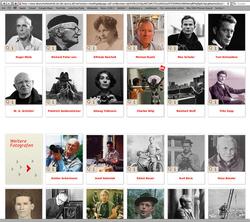
„Da wird eine Lawine auf uns zukommen. Viele Fotografen sind 60plus“, sagt Anna Gripp, Redakteurin bei Photonews. „Seit Langem beobachten wir, dass die Fotografen nicht wissen, wohin mit ihrem Bildern, wenn sie in die Jahre kommen.“ Im Juli 2010 erschien in der Zeitung für Fotografie eine Themenbeilage zu Fotoarchiven und Nachlässen. Die Reaktionen aus der Kollegenschaft machten deutlich, dass etwas geschehen muss.
Mit dem Ziel, eine Anlaufstelle für Fotografen oder deren Erben zu schaffen, lud Photonews wenige Monate später Vertreter der wichtigsten Fotografenverbände und Fotografie-Vereine zu einem ersten Treffen ein. Sie gehörten auch zu den Gründungsmitgliedern, als im Sommer 2011 der gemeinnützige Verein Netzwerk Fotoarchive offiziell gegründet wurde.
Kompetenzteam für Vernetzung.
Ziel ist es, Fotografen oder deren Erben bei der Suche nach einem Ort für ihre Bilder zu helfen und Institutionen bei der Sicherung und Aufarbeitung einzelner Archive zu unterstützen. „Wir verstehen uns als kleines Kompetenzteam“, erläutert Vereinsvorsitzende Gripp. „Unsere Stärke ist die Vernetzung der Verbände und engagierten Kräfte. Viel Geld oder Personal kann keiner von uns dafür einsetzen.“ Dafür erreicht man über die Verbände die betroffenen Fotografen und hat gute Kontakte zu sammelnden Institutionen, so zur Deutschen Fotothek, deren Leiter Jens Bove ebenfalls Gründungsmitglied des Netzwerkes ist.
Doch nicht nur die Fotothek bemüht sich sehr aktiv um fotografische Nachlässe. Über vier Millionen Bilddokumente zur Fotografie-, Kunst- und Technikgeschichte umfasst die Sammlung in Dresden. Rund anderthalb Millionen Aufnahmen sind online zugänglich und recherchierbar (deutschefotothek.de). Es gibt eine ganze Reihe öffentlicher Institutionen in Deutschland, die analoge fotografische Sammlungen langfristig aufbewahren, erschließen und sie für die Öffentlichkeit zugänglich machen.
Schritt für Schritt will das Netzwerk Fotoarchive Informationen über bestehende Archive und Institutionen sammeln und veröffentlichen. Die ersten Ergebnisse einer Umfrage, welche Sammlungsgebiete für die jeweiligen Institutionen von Interesse sind und zu welchen Bedingungen Bestände übernommen werden, sind bereits auf der Website netzwerk-fotoarchive.de zu sehen. Wie erwartet, gibt es einerseits Institutionen, die regional eingeschränkt sammeln, und anderseits solche, die thematisch beschränkt sind.
Fotografisches Erbe.
Wem die sorgsame Verwahrung und engagierte Vermittlung seines „fotografischen Erbes“ ein Anliegen ist, sollte rechtzeitig nach einer passenden Institution dafür suchen. Sonst kann es selbst bei berühmten Fotografinnen und Fotografen zu Problemen kommen. Die eigenen Erben damit zu belasten, ist sicher keine gute Lösung.
Erster Anlaufpunkt für Fotografinnen und Fotografen ist ebenfalls die Webseite des Netzwerkes. Unter „Vermittlung“ kann recherchiert werden. Von dort aus kann auch Kontakt zur einzigen Mitarbeiterin des Vereins, der promovierten Kunsthistorikerin Andrea Henkens, hergestellt werden.
Auch das Netzwerk Fotoarchive wird sicher nicht für alle Fotoarchive eine Lösung finden können. Aber es gibt etliche, die für regionale oder thematische Sammlungen interessant sein können. „Es gilt, die verschiedenen Seiten zusammenzubringen“, sagt Anna Gripp. Das will das Netzwerk Fotoarchive ab Sommer auch auf Veranstaltungen in einigen Großstädten versuchen. „Schließlich geht es doch auch um die Sicherung des kulturellen Erbes. Es wäre schade, wenn das auf dem Müll landet.“


