Es ist ein Rückblick auf eine lange und abwechslungsreiche Zeit als Journalist, Gewerkschafter, international engagierter Mensch, den Wolfgang Mayer, von 1977 bis 2011 Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten, in seinem neuen Buch „Gehetzte Journalisten – Begegnungen im Dauerlauf“ gerade vorgelegt hat. In kurzen Berichten, Anekdoten, Miniaturen erzählt er aus seinem beruflichen Leben von Begegnungen und Erfahrungen, die ihm überliefernswert erscheinen und von denen er viele selbst in der Voloausbildung bei den Nürnberger Nachrichten eingebaut hat.
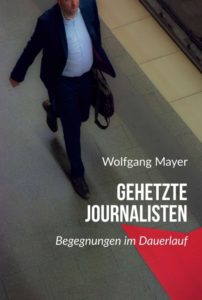
„Die Hetze im Beruf hielt mich stets auf Trab. Viele Erlebnisse drehen sich um Recherchen – und zeigen die Grenzen deren Möglichkeiten“, schreibt der Autor im „nachgeschobenen Vorwort“. „Die Einblicke in meinen beruflichen ‚Dauerlauf‘ zeigen unter anderem, dass es eine bisweilen herbeigeredete ‚Medienverschwörung‘ gar nicht geben kann.“ Denn „die Medien“ gebe es so gar nicht, dafür sei das Medienspektrum viel zu vielseitig. „Wenn Bürger verbal Medien prügeln, so ist das ein Ausdruck von Missfallen über Inhalte von Berichten: meist Handlungen und Äußerungen von Politikern.“ Diese zu berichten hält Mayer für die Chronistenpflicht der Journalisten. Er bestreitet aber auch nicht, dass in der Medienwelt einiges „schiefläuft“: „Die Arbeitsbedingungen geben den Grund dafür: Sie geben den Rahmen für die Berichterstattung und sind unerbittlich. Das Hauptproblem: Viele Redaktionen sind chronisch unterbesetzt.“
So berichtet Mayer vom monatlichen Ritual der Bundesagentur für Arbeit, das den Agenturjournalisten keine Zeit lasse, nach den Zahlen auch noch die Analysen zur Kenntnis zu nehmen. Oder er beschreibt Pressereisen, zu denen große Firmen im Nürnberger Verbreitungsgebiet wie Siemens einladen, die sogar die Jahrespressekonferenz an weit von ihrem Stammsitz Erlangen entfernten Orten abhalten und damit die heimischen Berichterstatter quasi zum Anreisen zwingen. Sind die Eindrücke aus dem Kupferbergwerk in den Anden, in dem Elektronik des Konzerns eingesetzt wird, den Aufwand wert? Korrumpiert die Reise, die es zeitlich nicht zulässt, die negativen Seiten des Erzabbaus auf die Umgebung zu untersuchen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Mayer immer wieder.
Ein weiteres Thema seines Journalisten-Mosaiks: Das Jagdfieber. Gibt man die Ergebnisse einer eigenen Recherche in einem Mordfall an die Polizei weiter – wo sie laut Mayer hingehören – oder schlachtet man sie gleich medial aus? Wann kann und soll man einen Deal mit der Polizei oder Staatsanwaltschaft machen, wenn es um laufende Ermittlungen geht? Sei es, um den Täter nicht zu warnen, sei es, um Mitbürger nicht in Panik zu versetzen. Wie kann man Informationen so verarbeiten, dass die Spur nicht zum Informanten führt, auch wenn man dafür auf den eigenen Namen unter der Story verzichten muss? Und wann bringt man sich während der Intifadah in Palästina lieber in Sicherheit, als noch unbedingt als rasender Reporter auf den Auslöser drücken zu müssen?
Doch nicht immer ist es bierernst in diesem Buch, so etwa, wenn Mayer über einen selbsternannten Gegenpapst stolpert, sich mit einer überzeugten Hexe über die Parkplatzsuche unterhält oder den Bruder des letzten Kaisers von China trifft.
Mayers Rückblick ist ein Buch voller kleiner Denkanstöße und hält immer wieder die Frage bereit: Was hätte ich in dieser Situation getan? Was soll man jungen Kolleginnen und Kollegen in ähnlichen Umständen raten? Entscheiden kann meist nur der/die Betroffene, und das häufig genug „im Dauerlauf“.


