In Zeiten von sinkendem Vertrauen in die Medien wirbt die Leipziger Medienforscherin Gabriele Hooffacker für mehr gegenseitiges Verständnis zwischen Journalist*innen und ihrem Publikum, indem sie journalistische Standards und wahrnehmungspychologische Einflüsse auf die Berichterstattung anschaulich erklärt.
Aufgelockert durch Quizfragen, die am Ende der Broschüre beantwortet werden, widmet die Autorin sich Fragen zur journalistischen Arbeit und zur Medienrezeption. So erklärt sie zunächst, „warum die Medien so arbeiten, wie sie arbeiten“ – eingeführt mit der Multiple-Choice-Frage nach der Bedeutung des Trennungsgebots.
Zur Auswahl stehen vier Antworten: Trennung von Biomüll und Plastikmüll, Tisch und Bett, Information und Meinung oder von guten und schlechten Nachrichten. Hooffacker erläutert, dass nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus für das Publikum deutlich werden sollte, was es bekommt: „Hier geht es um Information. Und dort geht es um Meinung. Damit sollte Propaganda im Gewand von Nachrichten vermieden werden.“ Es gebe allerdings Medien, die sich nicht an die Trennungsregel halten – etwa Boulevardblätter und social media.
Hostile-Media-Effect und Framing
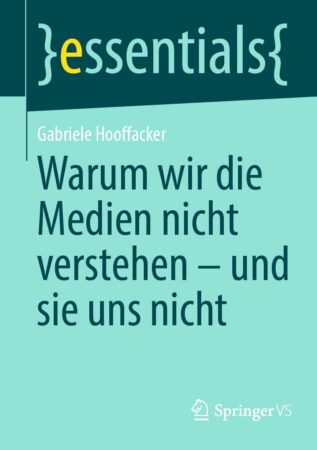 Es folgen Informationen zur häufig ereignisorienten Nachrichtenauswahl und zu ausgewogener Berichterstattung. Darunter verstehe man die Darstellung verschiedener Positionen, die vom Publikum aber zuweilen als verzerrt wahrgenommen werde. Das hänge mit dem Hostile-Media-Effect zusammen, den Hooffacker aus Rezipient*innensicht erklärt:
Es folgen Informationen zur häufig ereignisorienten Nachrichtenauswahl und zu ausgewogener Berichterstattung. Darunter verstehe man die Darstellung verschiedener Positionen, die vom Publikum aber zuweilen als verzerrt wahrgenommen werde. Das hänge mit dem Hostile-Media-Effect zusammen, den Hooffacker aus Rezipient*innensicht erklärt:
„Dabei kommt es zu einem putzigen Effekt. Wir sehen in der Tagesschau eine bestimmte Person, hören deren Position. Jaja, wir wissen schon, das fällt in diesem Fall unter Information, nämlich die Information über genau diese Position, genau dieser Partei. Aber es gefällt uns nicht. Es gefällt uns umso weniger, je entschiedener unsere eigene Position zu diesem Thema ist.“ So wird auch verständlich, warum unter einer stark polarisierten Gesellschaft das Vertrauen in Medien, die alle Seiten darstellen wollen, leidet.
Die Autorin erläutert weitere wahnehmungspsychologische Effekte – etwa „Framing“ von Nachrichten. Als Einordnungs- und Erkenntnishilfe diene dieser Deutungsrahmen dazu, Zusammenhänge zu verstehen, könne sich aber auch verändern. So wurden Geflüchtete 2015 als Opfer dargestellt, später primär als Kriminelle. Das Besondere beim Framing-Effekt sei, dass es zu ein und derselben Nachricht unterschiedliche Deutungsrahmen gibt. Das Publikum könne Frames der Medienberichterstattung aufgreifen, aber auch seine eigenen verwenden. Nach der Frage „Wer wirklich Einfluss auf die Medien nimmt, und wie sie damit umgehen“ resümiert Hoofacker, „was Medien und Publikum tun können“.
Konstruktiver Journalismus als Ergänzung
Journalist*innen empfiehlt sie konstruktiven Journalismus als Ergänzung zur klassischen ereignisorientierten Berichterstattung. Mit der Recherchefrage „Wie weiter ?“ könne man auch Handlungsoptionen und Auswege aus Krisensituationen aufzeigen. Für das Publikum sei fundierte, differenzierte Medienkritik „eine gute Idee“. Medienbeiträge sollten an journalistischen Standards gemessen werden. Es sei auch hilfreich, sich selbst wahrnehmungspsychologische Verzerrungen wie etwa Hostile-Media-Effect oder Framing bewusst zu machen. Diese beeinflussten sowohl das Publikum als auch die Medienmacher*innen. Daraus könne „ein besseres Verständnis der Medien erwachsen“.
Hooffacker schreibt locker und verständlich, versetzt sich dabei in die Perspektive von Medienrezipierenden. Doch auch Journalist*innen finden Anregungen zur Reflexion und im Literaturverzeichnis Stoff zum Weiterlesen.
Gabriele Hooffacker: Warum wir die Medien nicht verstehen – und sie uns nicht, Springer VS, Wiesbaden 2024, 32 Seiten, 14,99 Euro



