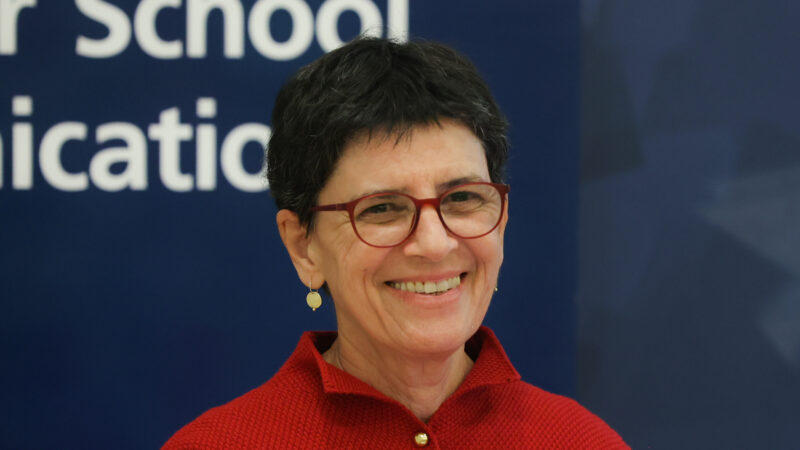Die israelische Tageszeitung Haaretz ist für ihre regierungskritische Haltung bekannt. Nun sollen Regierungsbehörden offenbar nicht mehr mit der Zeitung kommunizieren. Gegen den TV-Sender Al Jazeera besteht ein Sendeverbot. Ermöglicht wurde dies durch ein im April beschlossenes Gesetz, das das Verbot ausländischer Medien vorsieht, die als schädlich für die Sicherheit Israels angesehen werden. Wir sprachen mit der israelischen Journalistin und Gewerkschafterin Anat Saragusti.
Was sind die wichtigsten aktuellen Trends in der israelischen Medienlandschaft?
Insgesamt sind wir in Israel mit sehr intensiven Angriffen auf die Medienfreiheit konfrontiert. Sie sind Teil eines gut durchdachten Plans der derzeitigen Regierung. Eine der wichtigsten Dimensionen ist dabei eine Reihe von Gesetzen und Gesetzesentwürfen. Sie attackieren den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, etwa durch Gesetzesentwürfe, die auf seine Privatisierung abzielen oder das Budget an politische Inhalte binden.
Anat Saragusti
ist Journalistin und Filmemacherin. Sie ist zuständig für Pressefreiheit bei der israelischen Journalistenunion.
Welche Rolle spielen feindliche Übernahmen im Rahmen dieser Angriffe?
Bisher wurden sie in bestimmten Regulierungsgremien wie dem Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und in einigen Nachrichtenabteilungen durchgeführt. Gegen die Ernennung eines ehemaligen Knesset-Mitglieds, das als Verbündeter Netanjahus gilt, zur Chefredakteurin des Nachrichtensenders Channel 13 hat die Journalistengewerkschaft gemeinsam mit unserer Abteilung bei Channel 13 News eine Petition beim Obersten Gerichtshof eingereicht.
Letztlich ist es uns gelungen, diese Bemühungen zu stoppen. Channel 13 News hat nun einen professionellen Chefredakteur. Gegen die jüngsten Sanktionen, die die Regierung gegen die Zeitung Haaretz verhängt hat, um die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zu schwächen, haben wir ebenfalls eine Petition beim Obersten Gerichtshof eingereicht. Wir halten diese Sanktionen für illegal. Man kann nicht diejenigen begünstigen, die mit einem übereinstimmen, und diejenigen bestrafen, die einen kritisieren.
Haaretz ist eine wichtige und renommierte Zeitung, die nicht nur auf Hebräisch, sondern auch auf Englisch erscheint. Als liberale und säkulare Publikation wird sie von den Rechten oft als Verräterin am nationalen Interesse verleumdet und dämonisiert. Wie genau geht das vor sich?
Es gibt eine größere und sehr wirkungsvolle Verleumdungskampagne gegen Medienunternehmen, einzelne Journalisten und gegen die Pressefreiheit an sich. Diese Kampagne ist organisiert, orchestriert und wird manchmal sogar finanziert. Jedes Mal, wenn Netanjahu auf Sendung geht, entweder in einer Live-Übertragung auf seinen Social-Media-Konten oder im Fernsehen, sagt er etwas Hässliches gegen die Medien in Israel. Normalerweise nennt er sie „Vergiftungskanäle“ oder „Al-Jazeera-Kanäle“, um anzudeuten, dass sie Verrat begehen.
Das letzte Mal, als Netanjahu seine Live-Sendung selten für Fragen von Journalisten öffnete, beantwortete er nicht nur keine der Fragen richtig. Über den einzelnen Journalisten machte er sich lustig und diffamierte Journalisten im Allgemeinen als „Lügner“. Diese vergiftete Atmosphäre hat auch zu einer Zunahme von SLAPPS geführt. In Israel gibt es noch keine Definition von SLAPP im Rechtssystem, aber wir wissen von vielen Politikern, die alle Arten von Verleumdungsklagen gegen Journalisten zur Einschüchterung eingereicht haben.
Wie erreicht Premierminister Netanjahu vor dem Hintergrund dieser Dämonisierung des Journalismus und der Journalisten die israelische Öffentlichkeit?
Seit seinem erneuten Amtsantritt im Januar 2023 weigert sich Netanjahu, den israelischen traditionellen Medien ein Interview auf Hebräisch zu geben. Seit Beginn des aktuellen Krieges hat er endlos mit vielen amerikanischen Fernsehsendern und anderen Publikationen auf Englisch gesprochen, aber nur zwei Interviews auf Hebräisch geführt – beide für Channel 14. Dieser Sender betreibt allerdings keinen professionellen Journalismus und ist als israelische Version von Fox News hauptsächlich damit beschäftigt, Netanjahu persönlich zu unterstützen sowie Lügen und Verschwörungstheorien zu verbreiten, wie etwa, dass die Armee sich gegen Netanjahu verschworen habe und daher für den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober verantwortlich sei.
Zusammen mit der vorgeschlagenen sogenannten Justizreform ab 2023 klingen die Rhetorik und die Politik, die Sie beschrieben haben, nach dem klassischen Drehbuch rechtspopulistischer Regierungen, wie wir sie zum Beispiel aus Polen und Ungarn kennen. Dort haben die Regierungen sowohl die unabhängige Justiz als auch die Medien als machtbegrenzende Institutionen systematisch ins Visier genommen. Was ist das Besondere an der israelischen Situation unter Netanjahu?
Dass er angeklagt wird – unter anderem wegen Korruption in Bezug auf zwei sehr zentrale Medien, Yedioth Aharonot und Walla, um positive Berichterstattung zu erhalten. Da Netanjahu weiß, dass die Medien eine wichtige Rolle dabei spielen, wie er in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, will er die Berichterstattung kontrollieren. Zudem ermutigt er seine Wählerinnen und Wähler, bestimmte Medien zu hassen und insbesondere jene Journalisten, die über seinen Prozess berichten. Im Gegensatz dazu haben frühere rechtsgerichtete Regierungen in Israel das Justizsystem und mehr oder weniger auch die Pressefreiheit respektiert.
Normalerweise ist eine der ersten medienpolitischen Initiativen rechtspopulistischer Regierungen die Schwächung der bestehenden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Sie werden beschuldigt, Teil einer linksliberalen Elite zu sein, die sich gegen sie und ihre Anhängerinnen und Anhänger verschworen hat. Letztlich geht aber vor allem darum dort politisch loyales Personal zu platzieren. Wie ist das bei KAN, dem öffentlichen Rundfunk in Israel?
Dieser Schritt ist einfach, denn es ist das Geld Steuerzahler, das in diese Sender fließt. Was die Rhetorik angeht, kann man den Leuten leicht weismachen, dass KAN nicht die Stimmung „des Volkes“ widerspiegelt. Die Angriffe basieren auf der Idee, dass KAN nicht vielfältig genug ist, nicht alle Meinungen repräsentiert, dass der Sender insgesamt voll von Linken und ihre Nachrichtenredaktion verzichtbar sei.
Welche Bedeutung hat KAN in der israelischen Medienlandschaft?
KAN ist ein sehr wichtiger Akteur in der hiesigen Fernsehbranche. Sie wird auf den digitalen Plattformen im Allgemeinen sehr stark genutzt, einschließlich der Nachrichten. Für KAN arbeiten einige sehr starke Journalisten, die all diese politischen Missstände aufdecken. Im Gegensatz zum früheren öffentlichen Rundfunk, der bis 2017 existierte, ist die KAN in Bezug auf Budget, Regulierung und Nominierungen politisch unabhängig. Und genau deshalb ist sie im Visier der aktuellen Regierung.
Schon vor den aktuellen Angriffen hatten frühere Netanjahu-Regierungen versucht, eine eigene Gesellschaft für die Nachrichten zu gründen. Doch dann drohte die Europäische Rundfunkunion (EBU) erfolgreich damit, dass Israel dann nicht mehr am Eurovision Song Contest teilnehmen oder KAN keine Lizenzen für die Übertragung von Fußballturnieren erhalten könnte. Also machte die Regierung vorerst einen Rückzieher. Aber stets wird versucht, sich die Nachrichten unter den Nagel zu reißen.
Wie wirkt sich diese belastete und polarisierte Atmosphäre auf die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten in Israel aus?
Als Journalistengewerkschaft beobachten wir einen sehr besorgniserregenden Anstieg der Gewalt gegen Journalisten. Aufgehetzt durch all das, was ich beschrieben habe, werden die Menschen zunehmend gewalttätig gegen Fernsehteams und Journalisten. Seit ihrem Amtsantritt, seit der Ankündigung ihrer sogenannten Justiz-Reform und auch nach dem 7. Oktober sind in Israel viele Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung zu demonstrieren. In dieser aufgeheizten Atmosphäre auf den Straßen kommt es zu Gewalt gegen Bürgerinnen und Bürger und gegen Journalistinnen und Journalisten auch durch die Polizei, die unter dem rechtsextremen Minister Itamar Ben-Gvir steht.
Welche Rolle spielt die liberale Zivilgesellschaft Israels als Korrektiv gegen diese autoritären, illiberalen Tendenzen?
Die israelische Zivilgesellschaft ist gut organisiert, um die freie Presse und die institutionellen Medien vor all diesen Gesetzen, Gesetzesentwürfen und anderen Angriffen zu schützen. In letzter Zeit wurden Organisationen wie Association for Civil Rights in Israel oder Fake Reporter gegründet, die Aussagen von Politikern auf ihre Richtigkeit überprüfen. Das beeinflusst auch die Intensität und Geschwindigkeit, mit der die Mainstream-Medien Fakten überprüfen, wenn Netanjahu eine Rede hält und live auf Sendung geht.
Wie beurteilen Sie den Zugang zu verlässlichen Informationen in Bezug auf den aktuellen, auch in Israel kontrovers diskutierten Krieg in Gaza?
Wer Zugang zu Informationen haben will, kann sich informieren. Über ausländische Medien, über soziale Medien oder über Haaretz und einige kleinere unabhängige Medien, die angemessen über den Krieg in Gaza berichten. Das Problem mit den Mainstream-Medien ist, dass sie nicht darüber berichten, was in Gaza vor sich geht. In gewisser Weise erzählen sie immer noch und immer wieder die Geschichte vom 7. Oktober.
Woran liegt das?
Vor allem wegen der Geiseln, aber auch, weil der Großteil die israelischen Öffentlichkeit so sehr mit dem eigenen Kummer und Schmerz beschäftigt ist, dass er das Leid der anderen, vor allem der Menschen in Gaza, nicht wahrnimmt. Einigen Israelis sind sie egal, andere meinen, sie hätten es verdient, weil die Menschen in Gaza angeblich kollektiv die Hamas unterstützen würden. Die israelischen Mainstream-Medien versuchen, der Stimmung der Bevölkerung gerecht zu werden und sie nicht zu verärgern. Aber damit verraten sie ihre Rolle als Journalist*innen.
Das klingt nach einer sehr grundsätzlichen Kritik am israelischen Journalismus dieser Tage.
Zu Beginn des Krieges und in den ersten Tagen nach dem 7. Oktober waren es ausschließlich die Journalisten, die die israelische Öffentlichkeit über die Geschehnisse vor Ort informiert haben. Die Journalisten waren die ersten, die das Ausmaß der Ereignisse verstanden haben. Auch kurz nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober konnten sie feststellen, dass alle staatlichen Einrichtungen und alle Dienste zusammengebrochen waren.
Viele Menschen waren auf Freiwillige angewiesen. Vor allem diejenigen, die von der Hamas angegriffen wurden und diesem Massaker zum Opfer fielen, waren gezwungen, ihre Häuser zu verlassen, weil ihr Zuhause zerstört war. Der Staat war allerdings nicht für sie da, und sie mussten sich auf Freiwillige stützen. Die Medien spiegelten das sehr stark wider und waren kritisch gegenüber dem Staat – das muss man ihnen lassen. Aber seither verhalten sie sich mehr und mehr wie Cheerleader der Armee.
Was sind die größten Herausforderungen für israelische Journalist*innen, wenn sie über den aktuellen Gaza-Krieg berichten?
Die Armee will die Berichterstattung kontrollieren und entscheidet, wer in den Gazastreifen kann, mit welcher Einheit und für wie lange. Manchmal zieht sie es vor, zum Beispiel die New York Times mitzunehmen, um etwas zu zeigen, von dem sie wollen, dass es internationales Echo findet. Ein anderes Mal entscheiden sie sich für Channel 12, weil die Armee weiß, dass dieser Sender ihr gegenüber wohlwollender ist.
Allerdings gibt es in Gaza wegen der Hamas-Herrschaft auch keine unabhängigen Medien. Das alles macht das Sammeln von Evidenzen durch unabhängige Medien unmöglich. Außerdem gibt es eine militärische Zensur, die aus Sicht der Armee filtert, was veröffentlicht werden darf und was nicht. Jetzt, wo Krieg herrscht, ist die militärische Zensur sinnvoller, weil das Militär seine Operationen oder Planungen nicht offenlegen will. Ich verstehe das, aber manchmal geht die Zensur dennoch zu weit.
Was bedeutet der Krieg in Gaza für Sie als Journalistin?
In Kriegszeiten stehen wir vor einem großen Dilemma – und besonders in diesem Krieg, der sich zumindest zu Beginn auch für mich wie ein existentieller Krieg angefühlt hat. Er wirft die Frage auf: Wer bist Du? Bist du zuerst eine israelische Patriotin, die will, dass dein Land diesen Krieg gewinnt? Oder bist Du zuerst eine unvoreingenommene Journalistin, der seine Arbeit macht? Ich glaube nicht, dass es in einer solchen Situation eine einzige richtige Antwort auf diese Frage gibt.
Aber ich denke, das Dilemma besteht inzwischen nicht mehr. Als Journalistin muss man jetzt das ganze Bild, die ganze Realität vor Ort zeigen. Man kann Prioritäten setzen, aber man muss die Berichterstattung diversifizieren und darf die Armee nicht anfeuern. Ich bin seit vielen Jahren als Journalistin tätig und habe über diesen Konflikt sehr intensiv und ständig berichtet. Ich habe stets versucht, ehrlich darüber zu berichten, auch wenn das nicht immer leicht zu konsumieren war. Aber ich empfand das immer als meine Verantwortung.