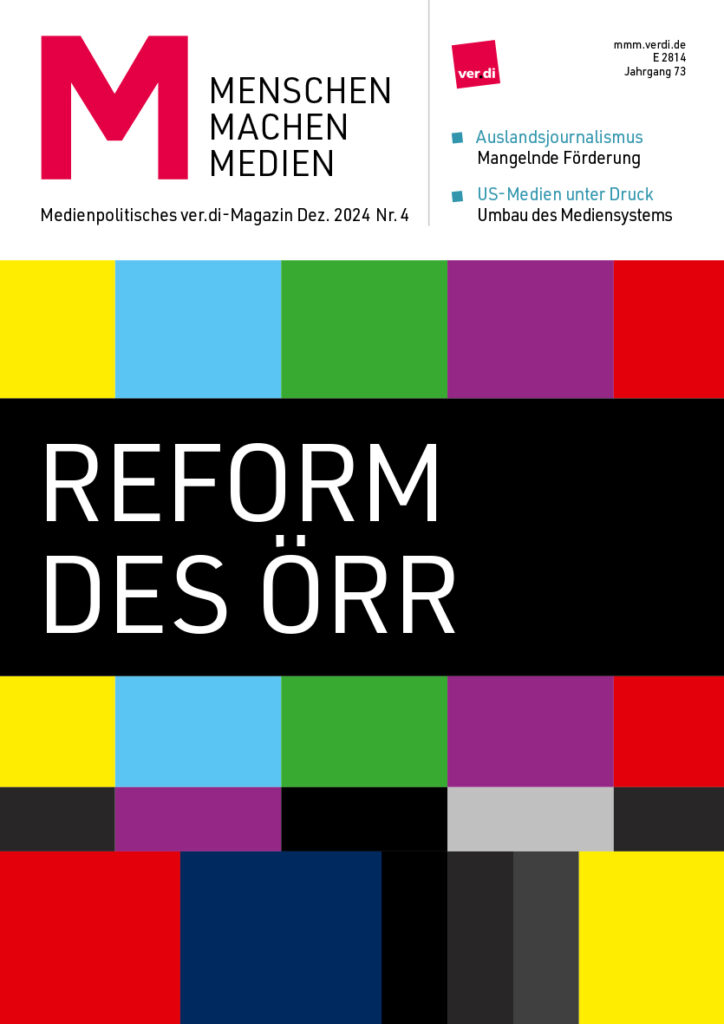Nachdem die Ministerpräsident*innen am 12. Dezember 2024 zur Rundfunkpolitik beraten haben, zeichnet sich ein düsteres Bild für die öffentlich-rechtlichen Medien, ihre Angebote und die dort Beschäftigten ab. Beschlossen haben die Ministerpräsident*innen eine Auftrags- und Strukturreform und einen ab 2027 geltenden neuer Mechanismus zur Festsetzung des Rundfunkbeitrags. Nicht verabschiedet wurde jedoch der fällige Rundfunkbeitragsstaatsvertrag.
Die nötige Erhöhung des Rundfunkbeitrags um monatlich 58 Cent ab 2025 konnte nicht auf den Weg gebracht werden. Begründet wurde dies mit den existierenden Rücklagen der Anstalten – die von der zuständigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten bei ihrer Beitragsempfehlung jedoch bereits berücksichtigt wurde.
Christoph Schmitz-Dethlefsen, für Medien zuständiges Mitglied im ver.di-Bundesvorstand, kommentiert:
„Das Gebaren der Ministerpräsident*innen in der Rundfunkpolitik ist nicht hinnehmbar. Indem sie die nötige Beitragserhöhung verwehren, brechen die Regierungschef*innen der Länder mit verfassungsrechtlich geregelten Verfahren.“
Die Rücklagen der Anstalten wurden von der KEF bereits berücksichtigt und die Beitragsempfehlung entsprechend abgesenkt. Das sei Realitätsverweigerung der Rundfunkpolitik. Für die Mitarbeitenden in den Medienhäusern sei dies ein düsterer Tag, denn unklare Finanzierung koste Programm und damit auch Aufträge für häufig jahrzehntelang im Rundfunk Tätige. Mit der Aussicht auf Programmeinschnitte seien dies auch schlechte Nachrichten für alle Mediennutzenden, so Schmitz-Dethlefsen.
Schwächung des ÖRR
Dies hänge auch mit der heute verabschiedeten Auftrags- und Strukturreform zusammen. Schmitz-Dethlefsen: „Inhaltlich schwächt die Reform die öffentlich-rechtlichen Medien insbesondere durch das weitreichende Verbot für Texte in Onlinepublikationen. Mit der Reform werden die Angebote für Mediennutzer*innen Angebote unattraktiver werden. Zudem war seit Monaten angekündigt, Auftrags- und Strukturreform nur im Junktim mit der gesicherten Finanzierung zu beschließen. Auch diese Ankündigung haben die verantwortlichen Politiker*innen heute gebrochen.“
„Damit schleifen die Ministerpräsident*innen die demokratierelevanten öffentlich-rechtlichen Medien – und das Vertrauen in die Politik gleich mit.“
Hinsichtlich des weiteren Verfahrens seien laut Schmitz-Dethlefsen nun das Bundesverfassungsgericht und die Landtage am Zuge. Die Länderchef*innen haben die Verantwortung dem Bundesverfassungsgericht und den Landtagen zugeschoben. Wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet, bleibt abzuwarten. „Derweil sind die Landtage nun aufgefordert, den Entwurf für die Auftrags- und Strukturreform zurück an die Ministerpräsident*innen zu weisen und eine zustimmungsfähige Überarbeitung zu verlangen – die zeitgemäße öffentlich-rechtliche Angebote für eine pluralistische Gesellschaft sicherstellt.“
Alles zum Thema ÖRR und die geplanten Reformen finden sie im Spezialheft der M: