Es ist der kommunikative Klimawandel, der den Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen weiterhin umtreibt. Bereits 2018 ist er in seinem Buch „Die große Gereiztheit“ dem Hass und der Hektik in der vernetzten Welt anhand von fünf Krisenphänomen nachgegangen. Seine Erkenntnisse diskutiert er nun in „ Die Kunst des Miteinander-Redens“ mit dem Hamburger Psychologen Friedemann Schulz von Thun in der bewährten, lebendigen Dialogform.
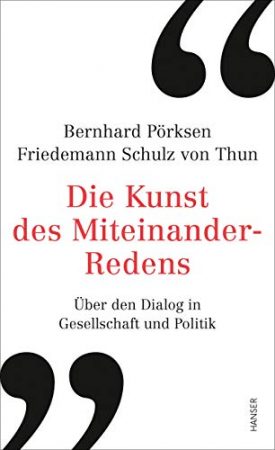
In ihren Gesprächen suchen Pörksen und Schulz von Thun nach Auswegen aus der sozialen Polarisierungsfalle durch einen zwischenmenschlichen Dialog, der auf Achtung beruht. Sie gliedern ihre Suche in vier Kapitel und veranschaulichen sie mit Beispielen und mit verschiedenen Variationen des „Wertequadrats“, das zeigt, wie man sich – abhängig von der jeweiligen Situation – stimmig zwischen Gegensätzlichem positionieren kann.
In „Dynamik der Polarisierung“ werden zunächst verhärtete Fronten am Beispiel der „Flüchtlingsdebatte“ analysiert: Willkommenskultur als „naive Harmoniebeschwörung“ contra nationale Abgrenzung als „kaltherzige Fremdenfeindlichkeit“. Mit Hilfe des Wertequadrats, das eine Brücke der Verständigung zwischen Teilwahrheiten bauen will, führt Schulz von Thun beide Standpunkte zusammen: Geflüchteten zu helfen, aber die Einwanderung verkraftbar zu machen. Pörksen fasst das in eine Leitformel zur Depolarisierung: „Du sollst nicht vorschnell generalisieren! Und dein Gegenüber nicht pauschal abwerten!“
Im zweiten Kapitel loten die beiden Wissenschaftler „Möglichkeiten und Grenzen des Dialogs“ aus. Sie plädieren für Respekt vor der Person – das heißt versuchen, sie zu verstehen und zumindest ein wenig zu würdigen und dann aber in der Sache den eigenen Standpunkt deutlich zu vertreten. Beim Umgang mit Pegida scheiden sich die Geister: Pörksen hält die Ächtung von Positionen, die den demokratischen Minimalkonsens verletzen, für notwendig. „Mit Rechten reden“ sei kein Problem, dass man lösen könne, sondern ein Dilemma, das immer mit Risiken behaftet sei, gibt Schulz von Thun zu bedenken. Ächtet man die Rechten, befördert das Polarisierung und Spaltung. Begegnet man ihnen mit Achtung, macht man sie hoffähig und stärkt sie.
Nach einem Gespräch über „Transparenz und Skandal“, das am deutlichsten an die „große Gereiztheit“ anknüpft, geht es im letzten Kapitel um „Desinformation und Manipulation“. Am Beispiel von Trump-Tweets, Strategien der amerikanischen Tabakindustrie und rechter Leugner*innen des Klimawandels wird verdeutlicht, wie durch eine „öffentlich wirksame Verwirrung“ der Wahrheitskonsens in demokratischen Gesellschaften unterminiert werden kann. Schulz von Thun ist mit Blick auf die Fridays-for-Future-Bewegung optimistisch. Man solle „ein wenig Vertrauen in die Menschheit“ bewahren. Pörksen bleibt skeptisch, denn solch ein positives Bild von aufgeklärten mündigen Bürger*innen sei an partizipative Kommunikationsstrukturen gebunden.
In einem Nachwort bilanziert Schulz von Thun Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen persönlicher und öffentlicher Kommunikation. Das von ihm entwickelte Kommunikationsquadrat („Die vier Seiten einer Nachricht“) lasse sich gut auf den politischen Raum übertragen. Als Beleg führt er Henriette Rekers Rat nach der Kölner Silvesternacht an: „Sobald ich den Mund aufmache, gehe ich das Risiko ein, dass meine Äußerung eine ganz andere Wirkung hat als beabsichtigt.“ Dieses Risiko sei in der öffentlichen Kommunikation viel größer als in der interpersonalen, denn hier werde die Botschaft von vielen Unbekannten aufgenommen und es sei noch wichtiger, „das Authentische und das Wirkungsbedachte aufeinander abzustimmen, den „Frame zielgenau zu setzen.“
Das Gespräch zwischen dem humanistisch-optimistischen Kommunikationspsychologen und dem eher kritisch-besorgten Medienwissenschaftler ist kurzweilig zu lesen und verdeutlicht, dass Kommunikation im persönlichen Dialog eher gelingen kann als im gesellschaftlichen Diskurs mit den unbekannten Vielen. Gerade Journalist*innen, die berufsethisch abwägen müssen, können mit dem Wertequadrat als „Werkzeug“ ein „geschärftes Dilemmabewusstsein“ entwickeln.
M – Der Medienpodcast: einzigartig anders, denn wir fragen genauer nach
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.


