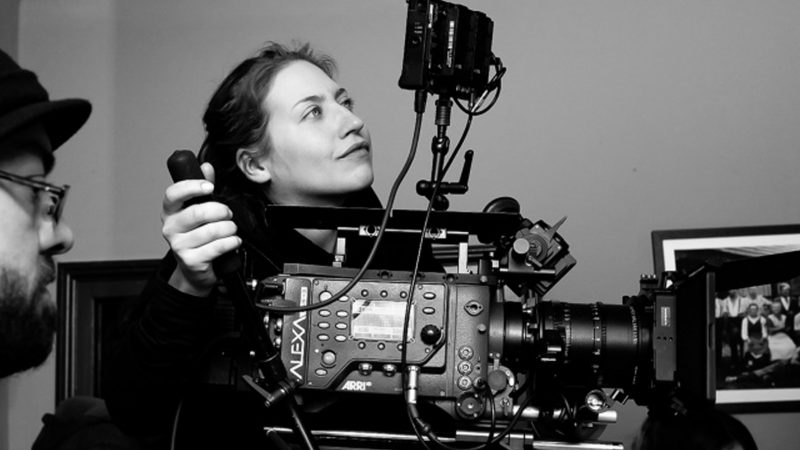Das Internationale Frauenfilmfestival (IFFF) bot auch in diesem Jahr ein politisch und kulturell anspruchsvolles Filmprogramm sowie anregende und mitunter erfrischend kritische Debatten. Zum Beispiel über die prekären Arbeits- und Lebensbedingungen von Filmschaffenden, die durch die Corona-Krise noch verschärft wurden. „Filmemachen ist Überlebenskunst“, sagt deshalb die in Argentinien geborene und seit 2016 in Berlin lebende Filmemacherin Melina Pafundi.
In Argentinien studierte Pafundi Film- und Videoregie, bildende Kunst und Philosophie, arbeitete zugleich im Buenos Aires Filmmuseum als Filmarchivarin. Erste Filme im Essaystil entstanden. Sie experimentierte mit filmischen Stilformen und komplexen Themen. Die Welt auf den Kopf zu stellen, sich zu fragen, wie man leben will, koste Arbeit und Kraft, so Pafundi gegenüber „M“. Exakt so sieht sie auch ihr Filmschaffen. Um Geld zu verdienen, habe sie in Argentinien zeitweise in einer Bank gejobbt. Sie hatte Schulden, wollte sich ihr eigenes Equipment und eine gute Kamera leisten. 2016, just als sie sich erfolgreich beim Nationalarchiv Film beworben hatte, kam der rechte neoliberale Präsident Mauricio Macri an die Macht: Es gab Massenentlassungen, darunter auch ihre zukünftige Chefin, aus ihrer Anstellung wurde nichts. Pafundi hatte schon Jahre zuvor begonnen, die deutsche Sprache zu lernen, weil sie von der deutschen Filmkultur der 1970er Jahre um Jutta Brückner, Werner Fassbinder, Edgar Reitz und Alexander Kluge begeistert war. Beeindruckt habe sie auch das Manifest 1962 von Oberhausen, das einst sehr konkrete Forderungen zur Filmförderung für unabhängige Filmemacherinnen und –filmemacher stellte.
Pafundi ist froh, ihren neuen Kurzfilm „When the androgynous child“ beim IFFF präsentieren zu dürfen. Doch die drückenden Finanzierungsprobleme sind damit nicht aus der Welt. Nebenbei arbeitet sie als Filmrestauratorin oder –vorführerin. Dann wieder jobbt sie als Kellnerin in einer Bar oder arbeitet in der Nachtbereitschaft bei „Evas Obdach“ mit obdachlosen Frauen. Bis eine Förderung zustande kommt, dauert es. Im April setzte der COVID 19-Virus vielem ein Ende. Vom Land Berlin erhielt sie 5000 Euro für kreative Solo-Selbstständige. Ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn in technische Anschaffungen für einen neuen Film investiert werden muss, um weiterzumachen, sagt die Filmemacherin. „Die Gewerkschaft sollte ein Gegengewicht zum neoliberalen Ausbeuten von Kreativen bilden.“ Die meisten hangelten sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten. „Kunst muss aber frei und unabhängig von der Marktlogik und potentiellen Geldgebern sein“, meint Pafundi.
Therese Koppe hat 2019 mit ihrem Dokumentarfilm „Im Stillen laut“ ihr Studium an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf abgeschlossen. Der Film, der beim IFFF lief, schildert das Leben von heute über 80-jährigen Künstlerinnen in der DDR und mit welchen Strategien und Utopien sie ihre Unabhängigkeit erhielten. Wie auch Pafundi muss Koppe einerseits mit Filmförderung das neue Dokumentarfilmprojekt teilweise vorfinanzieren und andererseits derweil mit anderen Jobs Geld auftreiben. Für die Entwicklung ihres Debütfilms über zwei namibische Frauen, die an dem Erbe der deutschen Kolonialherrschaft schwer zu tragen haben, erhielten sie und ihre Co-Autorin Lisa Skwirblies zwar eine Rechercheförderung von der Robert-Bosch-Stiftung und dem Literarischen Colloqium Berlin: drei Monate Honorar und Reisekosten. Doch mit dem Lockdown in Berlin endete ihr Projekt in der sechsten Klasse einer Schule unter dem Titel „Wie entwickle ich einen Dokumentarfilm?“. Ein Filmbildungsworkshop mit Kindern fiel ebenso zunächst flach, konnte dann aber nachgeholt werden. Auch sie erhielt 5000 Euro Soforthilfe für Solo-Selbstständige vom Land Berlin. Und ebenso wie Pafundi findet sie es anstrengend, oft kurzzeitig befristete Jobs ständig neu akquirieren zu müssen, um die Dokumentarfilmarbeit teilweise vorfinanzieren und ihr Überleben sichern zu können: „Ein regelmäßiger 20 Stundenjob nebenbei wäre prima.“
Grit Lemke, mit ihrem Film „Gundermann Revier“ (2019) beim IFFF vertreten, ist seit Jahrzehnten als freie Dokumentarfilmerin tätig, war zeitweise beim Filmfestival „DOK Leipzig“ als Kuratorin angestellt. Filmgespräche, mit denen sie ihren Film bekannt macht, waren während der Hochphase der Corona-Pandemie ausgesetzt. „Einerseits schade“, meint sie. Andererseits seien für diese Reisen, meist in den Osten der Republik, zwar Reisekosten bezahlt worden, vergütet worden aber seien sie oft nur mit etwa 200 Euro. Durch ihre zeitweise Festanstellung sowie einen Existenzgründungszuschuss von der Arbeitsagentur habe sie den Vorteil gehabt, Anspruch auf Arbeitslosengeld I zu haben, sei so gut durch die Corona-Krise gekommen. Für ihren neuen Film habe sie eine Förderung von 20 000 Euro erhalten und damit wieder zurück in der Selbstständigkeit gefunden. Das klinge nach viel Geld, wovon aber Vieles zu finanzieren sei, gibt Lemke zu bedenken: das eigene Honorar, Kameramann bzw. Kamerafrau, die Produktion von Probeszenen, technische Neuanschaffungen, der Schnitt. 10 000 Euro erhält die Filmemacherin gleich, die andere Hälfte der Förderung nach Abschluss des Filmprojektes. Nachwuchsfilmerinnen könnten es nicht stemmen, in Vorkasse zu gehen. Dies müsse unbedingt geändert werden, kritisiert Lemke. Weiterhin gelte es für die Kuratorinnen der Filmfestivals zu kämpfen. Obgleich sie unverzichtbarer Bestandteil von Kultur und Filmwirtschaft seien, gehörten Niedriglohn, Ausbeutung und Selbstausbeutung für viele zum Berufsalltag. Derzeit hätten Kuratorinnen nicht einmal die Chance, sich über die Künstlersozialkasse kranken-sozial- und rentenzuversichern, moniert Lemke. Das müsse sich ändern: „200 Jahre lang ist vieles erkämpft worden, wir müssen jetzt weitermachen.“