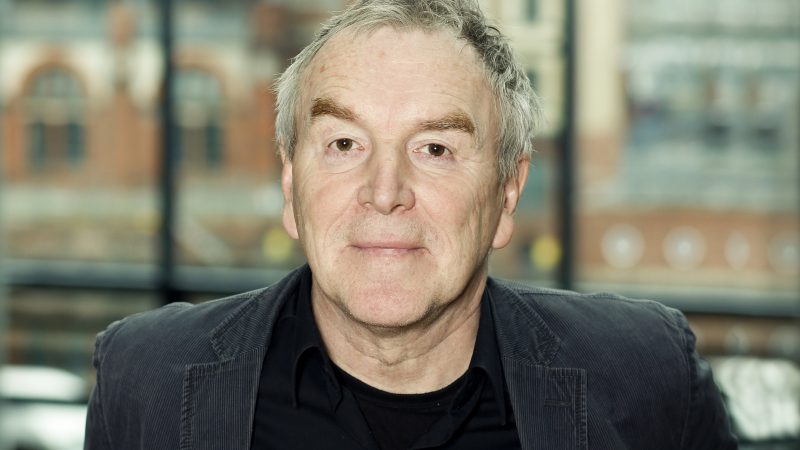Meinung
2018 – bei der gleichfalls umstrittenen WM in Russland – waren es im Schnitt noch jeweils 25 Millionen gewesen. In der gesamten Gruppenphase fiel die Zuschauerbilanz noch ernüchternder aus: 4,8 Millionen pro Spiel – das ist geradezu dürftig angesichts von stolzen 214 Millionen Dollar, die die öffentlich-rechtlichen Anstalten für dieses Produkt an den umstrittenen Weltfußballverband FIFA überwiesen hatten.
Auch wenn spätestens mit den Viertelfinalspielen der Besten das Zuschauerinteresse noch einmal spürbar anzog – unterm Strich bekam die WM genau die Aufmerksamkeit, die sie verdiente. Das lag vor allem an den skandalösen Rahmenbedingungen, unter denen das Mega-Event unter die Leute gebracht wurde. Mindestens seit fünf Jahren war bekannt, dass es bei der Vergabe an Katar 2010 nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Nicht sportliche Gründe, sondern der unversiegbare Strom von Petrodollars hatte(n) den Ausschlag gegeben – ähnlich wie bei der WM 2018 in Russland. Dazu die Auflage, aus klimatischen Gründen das Ereignis erstmals im Winter statt im Sommer stattfinden zu lassen, was hierzulande früh die Aussicht auf stimmungsvolles Public Viewing im Freien vereitelte.
Der Sport rückte in der Berichterstattung von Anfang an in den Hintergrund. Stattdessen ging es um Menschenrechtsfragen, um den Umgang Katars mit Arbeitsmigranten beim Bau der neuen Stadien, um die Diskriminierung der LGBTQI-Community im Emirat am Golf, um die Korruption bei der Vergabe des Turniers an die Scheiche. Vor allem schockierende Berichte über Todesfälle auf den WM-Baustellen verwandelten die Frage einer Teilnahme oder Nichtteilnahme der Fans – ob in persona oder als TV-Zuschauer – in eine moralische Entscheidung.
Die Medien lieferten durchaus exzellente Hintergrundprogramme, angefangen mit der vierteiligen ARD-Doku „Katar – WM der Schande“ bis zur ZDF-Reportage „Geheimsache Katar“ – das Stück gelangte zu trauriger Berühmtheit durch die Aussage des katarischen WM-„Botschafters“ Khalid Salman, der Homosexualität als „geistigen Schaden“ diagnostizierte. Bemerkenswert auch die beiden ARD-Fiction-Serien „Das Netz – Spiel am Abgrund“ und „Das Netz – Prometheus“ – sehenswerte Thriller über finstere Machenschaften im durchkommerzialisierten Profifußball.
Serviert wurden diese Programm-Highlights allerdings überwiegend vor der WM. Offenbar rechneten ARD und ZDF damit, dass sich die Stimmung im Verlauf des Turniers zumindest teilweise einstellen bzw. erholen würde. Eine Fehlkalkulation. „Wieso eigentlich“, fragte zu Recht TV-Kritiker Klaus Raab, „kann man nicht die ganzen kritischen Doku während einer WM bringen statt vorher – also nicht als Aufwärmprogramm fürs Turnier, sondern nach Flitzermanier direkt im Rahmenprogramm der Spiele? Wäre das nicht sogar die noch bessere Plattform für Kritik?“
Es gab sogar einen echten Flitzer: Zu Beginn der zweiten Halbzeit der Partie Portugal gegen Uruguay stürmte ein Mann das Spielfeld – und setzte dabei gleich mehrere politische Zeichen. Neben einer Regenbogenflagge trug er ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Save Ukraine“ („Rettet die Ukraine“), auf der Rückseite stand: „Respect for Iranian Woman“ („Respekt für iranische Frauen“). Das TV-Publikum bekam davon kaum etwas mit – entsprechend der FIFA-Praxis, im von ihr produzierten „Weltbild“ politische Meinungsbekundungen auf und neben dem Spielfeld zu unterbinden. Die ARD, die das Spiel übertrug, hatte allerdings eigene Kameras im Stadion und schnitt ihre Bilder gegen die der FIFA.
Ebenfalls vom FIFA-Weltbild zensiert wurde eine Aktion der deutschen Nationalelf. Die geriet allerdings zum Rohrkrepierer: Nachdem Regenbogen- und „One-Love“-Binde von der FIFA verboten worden waren, protestierten die Kicker bei der Aufstellung zum Mannschaftsfoto vor dem Japan-Spiel mit der vor den Mund gehaltenen Hand. Für dieses Einknicken vor der FIFA kassierten die Beinahe-Revoluzzer nach ihrem frühen WM-Aus Hohn und Spott. Ein in den sozialen Medien viel geteilter Clip zeigt Gäste eines katarischen Sport-TV-Talks, wie sie Deutschland mit einer ähnlichen Geste zum Abschied winken.
Wahrscheinlich ist es zu viel verlangt, im Geflecht von Sportverbänden, Sponsoren und Medien ausgerechnet von den Spielern einen erfolgreichen Einsatz für Menschenrechte und gegen die Kommerzialisierung zu erwarten. Und die Medien? Ist unter den von der FIFA diktierten Bedingungen an einem solchen Schauplatz überhaupt kritischer Sportjournalismus möglich? Oder bleibt zumindest den TV-Anstalten nur das Kerngeschäft – der Verkauf der lukrativen Ware Fußball?
Tatsächlich, diese Erkenntnis drängt sich auf, geht es bei der WM in Katar am allerwenigsten um Sport. Hier ist alles gekauft – das Ereignis selbst, viele Sportler, sogar ein Teil des Publikums besteht offensichtlich aus bezahlten Claqueuren. Der Kasus der soeben verhafteten griechischen Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili und dreier weiterer Korruptionsverdächtiger belegt, dass Katar alle schmutzigen Mittel recht sind, seine Interessen – in diesem Fall Visa-Liberalisierungen – zu beeinflussen.
Als zu Beginn des Turniers Argentinien sensationell gegen Saudi-Arabien verlor, jubelten Publikum und auch viele Medien über diesen „Coup“ des Underdogs. Beifall für die Saudis? Der investigative Sportreporter Jens Weinreich konnte es nicht fassen. „Das ist der nächste Sport-Schurkenstaat, geführt von Mohammed bin Salman, der Khashoggi mit einer Kettensäge hat ermorden lassen, der die WM 2030 will.“
Tatsächlich gibt es Pläne in Riad, sich um die Austragungsrechte für die übernächste WM in acht Jahren zu bewerben, als Drei-Kontinente-Option gemeinsam mit Ägypten und Griechenland. Da droht erneut ein Versuch, mit dem populärsten Fußballturnier der Welt Sportswashing für das eigene Image zu betreiben. Dass die Saudis es ernst meinen, zeigte sich Anfang Oktober. Da gab das asiatische Olympia-Komitee bekannt, dass die Asien-Winterspiele 2029 nach Saudi-Arabien vergeben werden. Winterspiele in einer eigentlich staubtrockenen Region – nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten eine Katastrophe. Die Proteste einer kritischen Öffentlichkeit halten sich einstweilen in Grenzen.