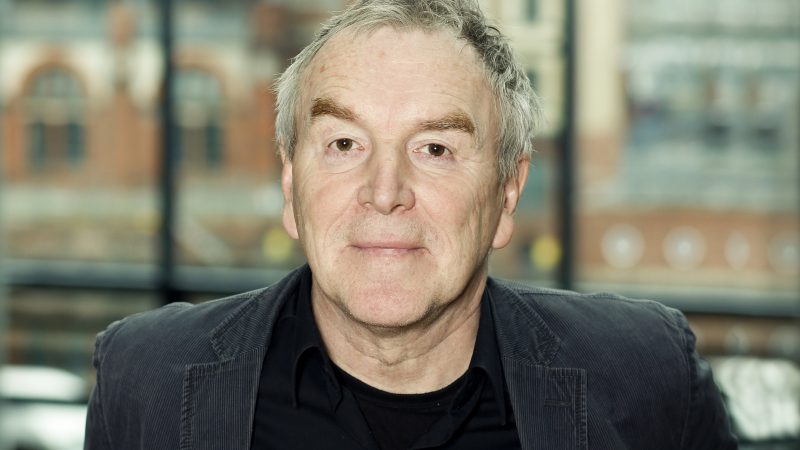Meinung
Wie aus der umstrittenen geleakten SMS hervorgeht, warnt Döpfner vor einer „Meinungsdiktatur“. Reichelt erscheint seinem obersten Dienstherr – noch kurz vor seinem Rausschmiss – als „der letzte und einzige Journalist, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeits-Staat aufbegehrt“. Was er damit wohl gemeint haben mag? Zum Beispiel die wütenden Attacken von „Bild“ gegen die Pandemie-Politik der GroKo? Die damit verbundene Hetze gegen den Virologen Christian Drosten? Oder die Kampagne gegen den von „Bild“ als „Steuer-Stasi“ gebrandmarkten Kampf des Grünen-Finanzministers von Baden-Württemberg gegen Steuerhinterziehung?
Dass dies nicht, wie er eilfertig und verharmlosend nachschob, eine zugespitzte, provokante Ansicht ist, noch dazu schändlicherweise aus einem privaten Kontext gelöst, hat Döpfner schon vielfach bewiesen. Der Mann glaubt wirklich, was er da sagt. Und gelegentlich auch schreibt. Der Anschlag von Halle 2019, bei dem ein Rechtsradikaler zwei Menschen erschoss und nur knapp daran scheiterte, ein Massaker in der dortigen Synagoge anzurichten, veranlasste den Konzernchef nicht etwa zu einer Warnung vor zunehmendem Rechtsextremismus. Stattdessen schimpfte er, „Deutschlands Politik- und Medieneliten“ schliefen den „Schlaf der Gerechten“ und träumten den „Wunschtraum der Political Correctness“. Wo es eigentlich geboten gewesen wäre, den Ursachen für Antisemitismus nachzugehen, machte Döpfner eine „rechtsstaatlich sehr zweifelhafte Flüchtlingspolitik“ als eine der Hauptursachen für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aus. „Rechtspopulistisches Geschwurbel“, urteilte der „Spiegel“. Die Verteidigungsrede für den später gefeuerten Reichelt war somit kein Ausrutscher, sondern offenbar Teil des Welt-Bilds von Döpfner.
Ohnehin erscheint die Frage berechtigt, ob die Kündigung von Reichelt wirklich eine autonome Entscheidung Döpfners war oder doch eher auf Druck der neuen US-Investoren von KKR erfolgte. Denn Sexskandale, das weiß der aufgeklärte Zeitgenosse, sind im puritanischen Amerika schlechter für’s business als jede andere Verfehlung. Und diese Geschäfte dürfen nicht gefährdet werden. Schließlich hatte Springer erst im vergangenen August das Portal „Politico“ für kolportiert eine Milliarde Euro gekauft.
Den BDZV stürzt Döpfners Verhalten nun in eine schwere Bredouille. Kann der Verband sich einen Präsidenten leisten, der en passant Journalist*innen der gesamten Branche (außer die der Springer-Medien, versteht sich) pauschal als Propaganda-Helfer diffamiert? Ausgerechnet der bislang als Feingeist geltende promovierte Musikwissenschaftler Döpfner offen auf dem Niveau von Pegida-Schwurblern und Lügen-Presse-Schreihälsen?
Jahrelang wähnten sich viele kleine und große Verlage durch Döpfner an der Spitze des Verbandes gut vertreten, sonnten sich gar im Glanze des charismatischen Konzernchefs und seinem Einfluss auf die große Politik. Dabei ist offensichtlich, dass die Interessen eines Großkonzerns wie Springer und kleiner Familienunternehmen nicht selten weit auseinanderliefen. Das zeigte sich schon früh in der Debatte um eine Lockerung der Fusionskontrolle bei Tageszeitungen, die eher den Branchengrößen als den Kleinverlagen gefiel. Auch in der Auseinandersetzung um das Leistungsschutzrecht favorisierte der BDZV unter maßgeblicher Einflussnahme Döpfners vor allem die Bedürfnisse der potenteren Verlage, nicht zuletzt die des eigenen Hauses.
Zuletzt erregte Springers Absicht, die jüngst übernommene News-App „Upday“ als Kurator für die bei Facebook News ausgespielten Presseinhalte einzusetzen, den Unmut unter deutschen Wettbewerbern. Nicht wenige Verlage argwöhnten, die Springer-Tochter werde die Inhalte der eigenen Marken „Bild“ und „Welt“ bevorzugen. Angesichts der wachsenden Unruhe lenkte Döpfner auf dem Verbandskongress im Juni ein und bot an, das umstrittene Upday-Mandat abzugeben und einer neutraleren Instanz zu überlassen.
Mit der Qualifizierung von Branchen-Kolleg*innen als „Propaganda-Assistenten“ scheint er nun den Bogen überspannt zu haben. „Völlig unpassend“ und „dem Amt eines BDZV-Präsidenten nicht angemessen“, kritisierte Funke-Geschäftsführer Christoph Rüth. Und auch Döpfners Stellvertreter im BDZV-Präsidium, Madsack-Geschäftsführer Thomas Düffert, hält die umstrittenen Äußerungen für „eine unangemessene und verfehlte Herabsetzung“. Noch gibt es keine offizielle Stellungnahme der Verbandsspitze. Aber die Ansicht Carsten Lohmanns vom Mindener Tageblatt, „jemand, der oberster Repräsentant der Tageszeitungen in Deutschland ist“, sei „mit so einer Aussage nicht mehr haltbar“, deutet an, wie stark es derzeit im Branchenverband rumort. Döpfners Rücktritt fordert auch „Stern“-Chef Florian Gless. Begründung: Mitwisserschaft von Machtmissbrauch und fehlgeleiteter Unternehmenskultur, „Querdenkerlyrik“ und Verharmlosung der Umstände.
Mit Reichelt wurde übrigens ein Chefredakteur gefeuert, der in seinem publizistischen Wirken jahrelang souverän den Kodex des Deutschen Presserats ignorierte. Was sich in einer Rekordzahl von öffentlichen Rügen ausdrückte, die von „Bild“ entweder gar nicht oder verspätet oder nahezu unauffindbar abgedruckt wurden. Ob Springer-Chef und BDZV-Präsident Döpfner seinen obersten Boulevard-Schmierer jemals zur Einhaltung des Pressekodex ermahnt hat? Unwahrscheinlich. Der Autorität des immerhin paritätisch aus Verleger- und Journalistenverbänden besetzten Selbstkontrollorgans der deutschen Presse hat er auch damit keinen guten Dienst erwiesen. Vermutlich ist sie ihm einfach – schnuppe.