Springer und kein Ende: Pünktlich zum 50. Jahrestag der Erschießung von Benno Ohnesorg untersucht der koreanische Historiker Dae Sung Jung in einer ungeheuer material- und quellenreichen Arbeit, „was die Anti-Springer-Kampagne eigentlich war, welche Rolle sie für die 68er Bewegung in der Bundesrepublik spielte und welche Bedeutung sie während und nach 1968 einnahm“.
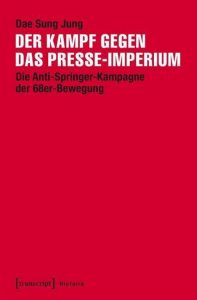
Am 2. Juni wird es ein halbes Jahrhundert her sein, dass der Berliner Polizist Karl-Heinz Kurras bei einer Anti-Schah-Demonstration vor der Deutschen Oper den Studenten Benno Ohnesorg erschoss. Dieses Ereignis und das ein Jahr später ebenfalls in Berlin verübte Attentat auf den SDS-Führer Rudi Dutschke waren Auslöser einer medienkritischen Kampagne, die sich innerhalb kürzester Zeit radikalisierte, bis hin zu Blockaden gegen den Axel-Springer-Verlag. Denn die Außerparlamentarische Bewegung (APO) machte vorausgegangene Hetzkampagnen des mächtigen Medienkonzerns gegen die APO und die Studentenbewegung für die beiden Bluttaten verantwortlich. „Die Kugel Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald“, sang seinerzeit Wolf Biermann in „Drei Kugeln auf Rudi Dutschke“.
Die Motive Jungs für seine Auseinandersetzung mit dieser Kampagne sind nach eigenem Bekunden „spezifisch koreanisch“. Auch in Südkorea sei seit langem eine „Monopolisierung des Pressemarktes“ zu beobachten. Drei dominierende konservative Zeitungen seien mit großen Konzernen verknüpft, die mittels dieser Medienmacht Einfluss auf die öffentliche Meinung und die Politik ausüben könnten. Ein Einfluss, der neuerdings durch Beteiligungen an Fernsehkanälen noch wachse. Mit seiner Analyse der Anti-Springer-Kampagne beabsichtigt der Autor, an der gegenwärtigen Bewegung für eine Medienreform in Korea zu partizipieren, gar aufzuzeigen, „dass es historische Vorläufer der Pressekritik gab, mithin Erfahrungen, an denen man sich heute in Korea orientieren könne“.
Jung sieht Springer als Verteidiger des Status quo, die APO als Kämpferin gegen das Establishment. Er analysiert die unterschiedlichen Positionen der Beteiligten, vom SDS über den Republikanischen Club bis hin zu der Springer-kritischen Fraktion in der Verlagsbranche. Die Kampagne sei keine eindimensionale Erscheinung gewesen, sondern verknüpft mit den Aktionen gegen Notstandsgesetze und Vietnamkrieg. Der Autor zeichnet den Übergang von einer reinen Aufklärungskampagne zum auch gewaltbereiten Aktionismus nach, der zum Rückzug bürgerlicher Unterstützer führte. Er kommt zu dem Schluss, dass die Bemühungen des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit, die APO-Kampagne maßgeblich zu beeinflussen, nicht erfolgreich waren. Ob der Konzernherr Axel Springer am Ende „als unmittelbare Reaktion auf die kritische Öffentlichkeit“ seine publizistische Expansionsstrategie einstellte, bleibt indes eine kühne These. Wahr ist allerdings: Bis heute gibt es Kritiker, die sich der Tradition der APO-Kampagne verpflichtet fühlen, von Bildblog bis hin zu den Campact-Protesten gegen unverlangt verteilte Gratis-Ausgaben von Bild.
Jung, Dae Sung: Der Kampf gegen das Presse-Imperium. Die Anti-Springer-Kampagne der 68er-Bewegung. Transcript Verlag, Bielefeld 2016, 376 Seiten, 34,99 Euro.


