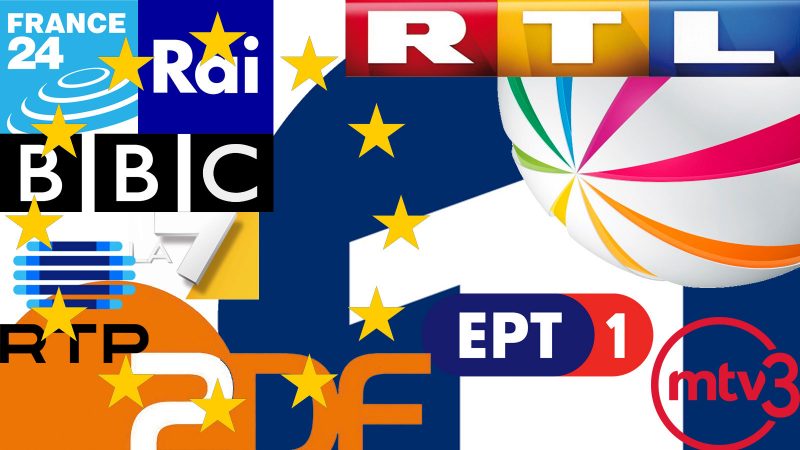„Eine für Alle? Möglichkeiten einer transnationalen Plattform für öffentlich-rechtliche und private Inhalte in Europa“. Unter diesem Titel lud die SPD-Bundestagsfraktion am 21. Februar zum ersten „Medienpolitischen Dialog“ dieses Jahres in das Berliner Reichstagsgebäude. Medienmacher*innen, -politiker*innen und Wissenschaftler*innen diskutierten mögliche Modelle einer nicht profitorientierten europäischen Öffentlichkeit.
Ein europäisches YouTube, das dem US-Internetriesen Paroli bieten und der profitorientierten Plünderung von Content Einhalt gebieten könnte: illusionär? Keineswegs! In der hiesigen Öffentlichkeit werden längst Modelle diskutiert, wie eine Plattform öffentlich-rechtlicher Anbieter mit Angeboten anderer Kultur- und Bildungsinstitutionen aussehen könnte.
Kein geringerer als ARD-Vorsitzender Ulrich Wilhelm hatte vor gut einem Jahr diese Debatte angestoßen. Das Thema liege „in der Luft“, stellte er jetzt fest. Während den einen der Erhalt kultureller Vielfalt besonders am Herzen läge, setzten sich andere vor dem Hintergrund der Datengefräßigkeit der US-Plattformen für den Aufbau einer eigenständigen Netz-Infrastruktur zur Spiegelung europäischer Inhalte ein. Wilhelm selbst konstatierte einen „Bruch im öffentlichen Raum“. Es gebe eine „wachsende Polarisierung in der Gesellschaft“, einen “Verlust an Zusammenhalt“. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit könnten auch verspielt werden. Es gehe darum, „die demokratische Vielfalt auch unter den Bedingungen der digitalen Gesellschaft“ zu erhalten und auszubauen. Dazu bedürfe es einer Ergänzung zu den Geschäftsmodellen der digitalen US-Konzerne. „Inhalte-Anbieter fänden es auf jeden Fall reizvoll, eine zusätzliche Alternative zu YouTube, Google und Facebook zu haben.“ Und dies sei primär eine politische Aufgabe. Normalerweise dürfe niemand einen Sender betreiben oder eine Zeitschrift herauszugeben, die rassistische Inhalte verbreite. Genau dies sei aber in sozialen Netzwerken möglich. Dort könne man „eigene communities bilden und damit in einem echten Wertebruch im öffentlichen Raum solche Inhalte propagieren, ausbeuten und zu einer Polarisierung der Gesellschaft beitragen“.
Cornelia Holsten, Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, sieht ARD und ZDF gegenüber den US-Internetriesen im Nachteil. Im Gegensatz zu Google und Co. könnten sie den Geschmack des Publikums nicht punktgenau ermitteln oder gar steuern. Aus Sicht der Medienaufsicht gelte: „Alles, was ein Angebot vervielfältigt, was also für die Meinungs- und Medienvielfalt bereichernd ist, wird von uns grundsätzlich unterstützt.“ Sie erinnerte jedoch an öffentlich-rechtliche und private Plattformen wie „Germany’s Gold“ und „Amazonas“, die am Veto des Bundeskartellamts gescheitert seien. Bei der Beurteilung solcher Projekte durch das Kartellamt spiele unter anderem der offene, diskriminierungsfreie Zugang eine zentrale Rolle. Holsten wünschte sich daher mehr Details über die potentielle Ausgestaltung einer Super-Plattform: Sollte eine Art europäisches YouTube angepeilt sein, müsse aus den Fehlern des US-Riesen gelernt werden. Daher sei ihr erster juristischer Reflex auf diese Idee gewesen, ob man das kartellrechtlich korrekt hinbekomme. Klärungsbedürftig seien zudem die Modalitäten der Finanzierung und des Datenschutzes.
Barbara Thomaß, Medienwissenschaftlerin an der Ruhr-Uni Bochum und zweite stellvertretende Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrates, machte sich stark für das Projekt „European Public Open Space“ (EPOS). Sie ist eine der 45 Erstunterzeichner*innen der „Zehn Thesen zur Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien“, in denen unter anderem ein stärkerer Beitrag der öffentlich-rechtlichen Anbieter zur europäischen Meinungsbildung gefordert wird. Es gehe um europäische Kommunikationsräume, die „frei sind von staatlichen und wirtschaftlichen Einflüssen“, so Thomaß. Als vier konstitutive Elemente von EPOS nannte sie die öffentlich-rechtlichen Medien, Wissensinstitutionen wie die virtuelle Bibliothek Europeana, zivilgesellschaftliche Einrichtungen wie Wikipedia sowie die Bürger*innen selbst. Letztere seien „notwendig, weil durch sie über Kommentare, Empfehlung, Kuratierung, Inhalteproduktion und Governance die wiederkehrende Forderung nach einem nichtkommerziellen YouTube und nach Partizipation als der Grundlage gesellschaftlicher Integration realisiert wird“. EPOS könne eine einzige europaweite Plattform sein, die alle Inhalte und Funktionen in 24 Amtssprachen für alle zum Filtern bereit stelle. Alternativ könnten es auch mehrere thematisch getrennte Plattformen sein. Denkbar wäre eine „Meta-Site, die Inhalte von Tausenden von föderierten Partnersites aggregiert und kuratiert oder auch ein Netzwerk dezentraler Produktion und Distribution wie investigate-europe.eu“. EPOS sollte über ein gemeinsames Wertesystem verfügen. Thomaß nannte Demokratierelevanz, Nichtkommerzialität, Datensicherheit, Nutzerkompetenz, Vernetzungsoffenheit und inhaltliche Vielfalt. Die zentrale Rolle beim Vorantreiben von EPOS schreibt sie den öffentlich-rechtlichen Medien zu: „Ihr Zusammenschluss in der EBU (Europäische Rundfunkunion, Anm.d.Red.) kann der Rahmen sein, in dem Entsprechendes entwickelt wird.“ Gerhard Pfennig, Sprecher der Initiative Urheberrecht, verwies in diesem Zusammenhang auf mögliche Konflikte zwischen Plattformbetreibern sowie Produzenten und Urhebern. Neue digitale Auswertungsmöglichkeiten müssten angemessen vergütet werden. Exklusivansprüchen von Plattformbetreibern steht er skeptisch gegenüber. Urheber und Verwerter müssten die Freiheit behalten, ihre Werke auch noch anderweitig zu verbreiten.
Martin Rabanus, medien- und kulturpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, will die Debatte über eine europäisch angelegte Kommunikationsplattform jedenfalls weiter vorantreiben. Dieser Prozess müsse politisch gesteuert werden. Offen sei für ihn aber weiterhin, ob eine solche gemeinwohlorientierte Plattform keinerlei kommerzielle Inhalte haben oder auch für private Anbieter offen sein sollte.