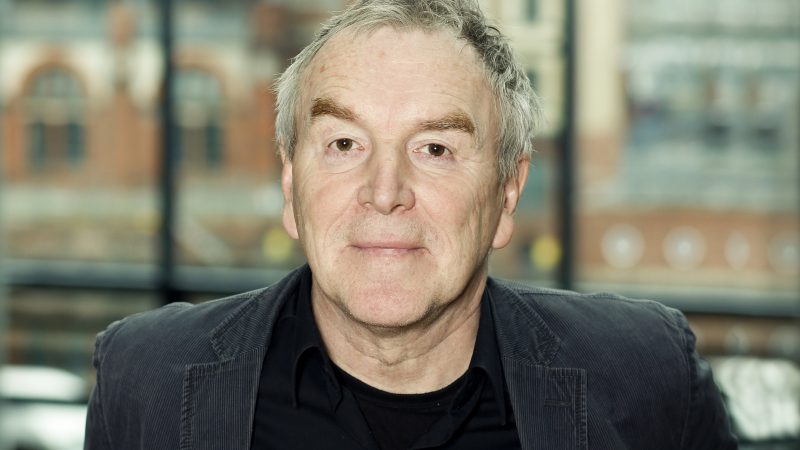Meinung
Abschiebung soll erleichtert werden. Wenn auch – aus technischen Gründen – nicht „in großem Stil“, wie es erst kürzlich der Sozialdemokrat Olaf Scholz auf dem Cover des Spiegel forderte. Das Gesetz sieht vor: Verschärfte Abschiebehaft, Kürzungen der Leistungen für Asylbewerber*innen, weitreichende staatliche Befugnisse bei der Durchsuchung von Geflüchtetenunterkünften, Ausweitung von Telekommunikationsüberwachung, Eröffnung der Möglichkeit, humanitäre Hilfe als Schleusertätigkeit zu kriminalisieren.
Sie nennen es Rückführungsverbesserungsgesetz
Manche Rechtsexpert*innen halten diesen Hardliner-Kurs in der Migrationspolitik für verfassungswidrig, nennen ihn „Wasser auf die Mühlen von Rechtsextremen“. Was den Kanzler und seine Außenministerin freilich nicht daran hinderte, sich in ihrem gemeinsamen Wahlkreis Potsdam an den Protesten gegen „Rassismus und Faschismus“ zu beteiligen. Ein Umstand, der zumindest stutzig machen sollte. Einigen ist es aufgefallen. „Um es klar zu sagen“, kommentierte etwa die Lausitzer Rundschau: „Das Rückführungsverbesserungsgesetz ist ein populistischer Popanz.“ Und die Frankfurter Rundschau urteilte, die Koalition lasse sich „von einer immer aggressiveren migrationsfeindlichen Debatte dazu treiben, Zehntausenden geflüchteten Menschen massive, in elementare Grundrechte eingreifende Gesetzesverschärfungen zuzumuten“.
Sprache soll besänftigen
Sprachliche Verschleierungsmanöver der Politik, mit denen unschöne Maßnahmen der Exekutive drapiert werden, sind nichts Neues. Gerade auf dem Feld der Asyl- und Geflüchtetenpolitik fühlen sich Politiker*innen offenbar immer wieder genötigt, ihr Handeln mit mehr oder weniger eingängigen und verharmlosenden Titeln schönzureden. Wenn Medien darüber berichten, sollten sie diese Begriffe kritisch hinterfragen. Beim – „Rückführungsverbesserungsgesetz“ ist das nicht immer gelungen. Das Wortungetüm hat einen Vorläufer aus der Ära der letzten GroKo. Unter dem damaligen CSU-Innenminister Horst Seehofer gab es schon einmal ein „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ – oder, in der formelleren Variante – das „Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“. Das Paragrafenwerk drohte unter anderem für die Verbreitung von Informationen über Abschiebeflüge per Newsletter oder in sozialen Medien mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren. Es attackierte also nebenbei auch die Presse- und Informationsfreiheit.
Geschichte der Kampfbegriffe
Framing heißt die gerade in der Politik beliebte Methode. Mit Hilfe der sprachlichen Verpackung bestimmter Botschaften wird je nach Bedarf Akzeptanz oder Ablehnung im Wahlvolk erzeugt. In Seehofers „Masterplan Migration“ (Begründung: „Die Migrationsfrage ist die Mutter aller politischen Probleme in unserem Land“) waren seinerzeit auch sogenannte „Ankerzentren“ vorgesehen. Eine euphemistische Bezeichnung für spezielle Unterkünfte, in denen Asylsuchende festgehalten werden sollten, bis sie auf die Kommunen verteilt oder in ihr Herkunftsland abgeschoben wurden. Zivilgesellschaftliche Organisationen verwiesen zu Recht auf den Zynismus, der im Wecken positiver Assoziationen des Begriffs Anker (Festmachen in einem Hafen, Sicherheit, christliches Symbol der Hoffnung) steckte. Dennoch schaffte es die Bezeichnung 2018 in den Koalitionsvertrag von CDU/CSU/SPD und wurde in der Folge einigermaßen unkritisch von vielen Medien übernommen. Das Unwort des Jahres wurde damals übrigens der von CSU-Mann Dobrindt geprägte Kampfbegriff „Anti-Abschiebe-Industrie“.
In jüngster Zeit haben vor allem die Haushaltsnöte der Ampel-Regierung eine Fülle kreativer Wortschöpfungen hervorgebracht. Da die Kassen leer sind, wird mal eben ein „Sondervermögen“ aus dem Boden gestampft, wo in Wahrheit neue Schulden gemacht werden. Ähnlich verhielt es sich mit dem „Tankrabatt“ – beim autofahrenden Volk als verbilligter Sprit gutgeheißen. Dabei ging es schlicht um eine Senkung der Energiesteuer, die obendrein den Mineralölkonzernen mehr half als den Verbraucher*innen. In den meisten Medien setzten sich diese Begriffe durch. Redaktionen lieben offenbar einprägsame, leicht verständliche Schlagworte – und tappen dabei in die Falle geschickter Polit-PR-Strategen.
Das Schnelle-Hundekacke-Wegmach-Gesetz
Besonders enervierend bei der „Verkaufe“ ihrer Gesetzesvorhaben agierte Berlins frühere Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey in ihrer Zeit als Familienministerin. Mit Namen wie „Gute-Kita-Gesetz“ oder „Starke-Familien-Gesetz“ pflegte sie einen geradezu inflationären Gebrauch von Begriffen mit gewollt positivem Signalcharakter. Die Redaktion des Tagesspiegel wehrte sich gegen derlei sprachliche Zumutungen mit einer Mitmach-Einladung an die Leserschaft zum fröhlichen Sprachframing. Die Resonanz fiel überwältigend aus. Einige Favoriten: „Schnelles-Hundekacke-Wegmach-Gesetz“, „Klare -Kante-gegen-Clans-Erlass“, „Funky-Frauenförderungs-Verfügung“.